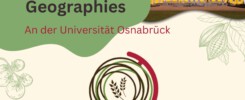Zusammenfassung der 4. Jahrestagung
3. – 4. April 2025 an der Universität Osnabrück
Zur nun bereits vierten Jahrestagung des 2022 gegründeten Arbeitskreises „Agri-Food Geographies“ lud die Professur für Humangeographie mit wirtschaftsgeographischem Schwerpunkt, geleitet von Prof. Dr. Martin Franz, am 3. und 4. April 2025 nach Osnabrück ein. Nach einer Begrüßung stellte Martin Franz den rund 40 Teilnehmenden zunächst das im Oktober 2024 angelaufene Graduiertenkolleg „ECORISK: Ecological Regime Shifts and Systemic Risk in Coupled Social-Ecological Systems“ (Link zu ECORISK) vor. Das Kolleg widmet sich der Untersuchung von ökologischen Regimewechseln und systemischen Risiken in gekoppelten sozio-ökologischen Systemen und wird fünf Jahre lang von der DFG gefördert.

Die drei Beträge der ersten Session der Tagung wurden von Mitgliedern des ECORISK-Graduiertenkolleg gestaltet. Christine Heinzel stellte zunächst ihre Arbeit zu Klimaextremen und Unsicherheiten in landwirtschaftlichen Entscheidungsprozessen in Niedersachsen vor. Anhand eines theoretischen Modells untersucht sie, wie verschiedene Formen von Unsicherheit von Akteuren wahrgenommen und bewältigt werden, und wie sie deren Entscheidungsfindung bzw. Wahl von Anpassung oder Nicht-Anpassung beeinflussen. Eine Umfrage niedersächsischer Landwirte wurde auf Basis des Modells bereits durchgeführt, deren Ergebnisse Christine Heinzel präsentierte. Diese Erhebung erlaubt erste Einblicke in die Dynamik von Unsicherheiten in der landwirtschaftlichen Praxis und deren Relevanz für die Entwicklung proaktiver Anpassungsstrategien.
Im Anschluss widmete sich Michel Ortland den Auswirkungen der von internationalen Organisationen empfohlenen und zunehmend von EU und nationalen Regierungen formulierten „Human Rights and Environment Due Diligence“ (HREDD)-Gesetzgebung. HREDD zielt darauf ab, Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und negative Umweltauswirkungen, die entlang von Wertschöpfungsketten entstehen, zur Verantwortung zu ziehen. In seinem Vortrag beleuchtete Michel Ortland die Auswirkungen der Lieferkettengesetze auf die Ananas-Wertschöpfungskette in Costa Rica, dem größten Exporteur dieser Anbaufrucht. Der Ananasanbau expandierte in den letzten Jahrzehnten sehr stark und zählt heute zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes, hat aber mit erheblichen ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsproblemen zu kämpfen, die allein durch internationale Gesetzgebung nicht zur lösen sein werden.

Zum Abschluss des ersten Tagungsabschnitts kehrte Blerim Berisha noch einmal zu den niedersächsischen Landwirten zurück und stellte seine qualitative Forschung zum Thema „Zwischen Wandel und Stillstand – Risiko in der Landwirtschaft in Zeiten der Polykrise“ vor. Davon ausgehend, dass Landwirte in einem sich stetig im Wandel befindenden ökologischen, ökonomischen und politischen Umfeld immerwährenden Risiken ausgesetzt sind und Entscheidungen treffen müssen, die mit vielfältigen Unsicherheiten behaftet sind, untersucht er, wie unterschiedliche Risikofaktoren wahrgenommen und gemeistert werden. Für seine Analyse nutzt er ein theoretisches Modell, das die Erkenntnisse aus der Risikoforschung mit dem „Model of Private Proactive Adaptation in Agriculture“ (MPPA) verknüpft und auf der „Protection Motivation Theory“ (PMT) basiert. Erste Ergebnisse einer Umfrage unter Landwirten in Niedersachsen, die das dieses Modells anwendet, wurden vorgestellt.
Nach der Pause gab Anika Trebbin vom Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig Einblicke in ein aktuelles Forschungsprojekt zur Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln und stellte Strategien des „Corporate Carbon Management“ vor. Sie zeigte, dass große Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft aufgrund ihrer zentralen Rolle in Wertschöpfungsprozessen immer stärker im Fokus bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen stehen, jedoch Maßnahmen beispielsweise zur Reduktion von CO2-Emissionen aktuell nicht einheitlich reguliert sind und daher Möglichkeiten für Greenwashing bieten.
Marc Daferner und Gerhard Rainer von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt berichteten im Anschluss von Prinzipen und Praktiken der Naturweinherstellung und -vermarktung. In einem qualitativen Ansatz untersuchten die Autoren die zugrundeliegenden Praktiken der Herstellung sogenannter natürlicher oder low intervention-Weine. Sie schlugen in ihrem Vortrag vor, die Praktiken der Naturweinherstellung und die zugrundeliegende Philosophie – d.h. die Koproduktion mit der Natur – im Rahmen eines Ansatzes, der konzeptionelle Ideen der More- than- human geographies aufgreift, weiter zu erforschen.
Den Abschluss der zweiten Session bildete Linda Hering von der Humboldt-Universität zu Berlin mit einem Vortrag zu sogenannten Hawker Centres in Singapur, die nicht nur leicht zugänglichen und bezahlbaren Zugang zu Lebensmitteln in den Wohnvierteln bieten, sondern auch als Begegnungszentren für Menschen der verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten dienen und zum integralen Bestandteil der Stadtplanung und nationalen Identitätsbildung des Stadtstaates geworden sind. Linda Hering legte in ihren Ausführungen über die Hawker Centres Singapurs, die 2020 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurden, den Schwerpunkt auf die Aspekte der Kontrolle und Regulierung des nationalen Territoriums, der Gestaltung des bebauten Raumes sowie der Verknüpfung mit entsprechenden Wissensbeständen.
In der dritten Session der Tagung befasste sich Peter C. Frandsen (Universität Osnabrück) mit der unsicheren Zukunft von Agri- und Aquakultur in Bangladesch. Anhand einer Fallstudie im westlichen Ganges-Delta untersuchte er die Veränderung der Landnutzung und ihrer Ursachen. Land Use and Land Cover (LULLC) -Daten zeigen, dass die Aquakulturnutzung nach einer Phase der Expansion stagniert, ja sogar zurückgeht, es sogar zu Versiegelung von Flächen und Sandauffüllung kommt. Dafür verantwortlich sind endogene (ökologische Probleme, soziale Veränderungen) sowie exogene Faktoren (politische Rahmenbedingungen, ökonomische Entscheidungen durch Investoren). Die Frage, die sich für die Zukunft stellt, ist, wie sich die beginnenden Industrialisierungsprozesse in Zukunft auf die agrarische Nutzung in diesem ländlichen Raum auswirken werden.
Für seinen Vortrag wählte Hauke Kruse von der Leibniz Universität Hannover (wie bereits Vortragende aus der ECORISK-Gruppe) den aktuellen Bezug der multiplen Krisen. In einer Studie in Niedersachsen auf der Basis von 22 Expert*inneninterviews untersuchte er die Betroffenheit und Anpassungsstrategien von mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen (MSMEs) aus dem Bereich von Produktion und Vertrieb nachhaltiger Lebensmittel. Dabei stellten die unterschiedlichen Krisen (COVID-19-Pandemie, Ukraine-Krieg, steigende Lebensmittel- und Energiekosten) unterschiedliche Herausforderungen mit unterschiedlichen Folgen. Die Persönlichkeit der Unternehmer, Organisationsform und Alter der Unternehmen, ihr geographischer Standort sowie die Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen waren wichtige Variablen der Resilienz gegenüber Krisen.
Einen wichtigen Beitrag zur Klimakrise bietet die Substitution tierischer Produkte durch pflanzliche Alternativen. Allerdings bedauerte Peter Rothe von der Technischen Universität Dresden in seinem Vortrag die bisher mangelhafte Auseinandersetzung mit dem Thema der Essbarkeit (Edibility) bzw. veganen Ernährungsweise in der Geographie/Food geography. Als wichtigen ersten Schritt präsentierte er Ergebnisse einer systematischen Durchsicht der Literatur zu diesem Thema, mit dem Schwerpunkt auf räumliche Bezüge. Die Analyse anhand des TPSN (Territory – Place – Scale – Network)-Ansatzes soll die Basis für ein umfassenderes Verständnis der räumlichen Komponenten unserer täglichen Ernährungsgewohnheiten bilden.
Das gemeinsame Abendessen in einem syrischen Restaurant in der Osnabrücker Innenstadt bot eine Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen und dem vertieften Austausch von Erfahrungen.

In Session 4 am Freitagmorgen analysierten Martin Franz, Thomas Neise, Steffen Niehoff und Hajo Holst (Universität Osnabrück) die Hintergründe und Ursachen der Unzufriedenheit landwirtschaftlicher Akteure von Landwirt*innen in Deutschland mit der Nachhaltigkeitstransformation. Die breite Protestwelle im Winter 2023/2024 richtete sich gegen sinkende Einkommen, steigende Betriebskosten, zusätzliche Umweltauflagen sowie gegen Freihandelsabkommen. Die Referenten zeigten auf Basis einer Online-Umfrage von 1008 Landwirt*innen und 33 qualitativen Interviews, dass der ökonomische Druck, geringe gesellschaftliche Wertschätzung sowie unklare agrarpolitische Rahmenbedingungen maßgeblich zur Ablehnung aktueller Transformationsprozesse beitragen. Darüber hinaus wurde deutlich, dass unter Landwirt*innen sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie nachhaltige Landwirtschaft konkret aussehen soll und wer deren Entwicklung legitim bestimmen darf.
Im Anschluss stellte Judith Müller von der Universität Heidelberg ihre Forschung zu Solidarischen Landwirtschaften (Solawis) als Orte sozial-ökologischer Transformation vor. Aufbauend auf Ansätzen der feministischen politischen Ökologie analysierte sie intersektionale Gerechtigkeitsfragen innerhalb deutscher Solawi-Initiativen. Die Studie, angesiedelt im Forschungsprojekt Food for Justice, beleuchtet, wie soziale Kategorien wie Klasse, Geschlecht oder Herkunft das Engagement in Solawis beeinflussen, und geht der Frage nach, ob diese Initiativen tatsächlich als gerechte Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft fungieren. Am Beispiel der Region Heidelberg, die eine lange Tradition im Gemüseanbau hat, wurde aufgezeigt, wie Solawis eine Lücke füllen können, die durch den Rückgang kleinbäuerlicher Strukturen entstanden ist.
In Session 5 analysierte Doris Schmied (Universität Bayreuth) in ihrem Vortrag zur urbanen Transformation in Italien das Phänomen der sogenannten Foodification. Der Begriff beschreibt die zunehmende Ökonomisierung und Aufwertung urbaner Räume durch gastronomische Angebote, insbesondere in italienischen Städten wie Bologna, Mailand oder Neapel. Die Präsentation zeigte, dass dieser Prozess häufig als Strategie zur Stadterneuerung gefördert wird, gleichzeitig aber auch Prozesse wie Gentrifizierung, Touristifizierung oder soziale Exklusion verstärkt. Der Vortrag machte deutlich, dass Foodification Teil größerer, ambivalenter Stadtentwicklungsprozesse ist, die zunehmend Kritik hervorrufen.
Amelie Bernzen (Universität Vechta), Hannah Lang und sowie Christine Bonnin (University College Dublin) stellten im Anschluss ihre Untersuchung zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Lebensmittelweitergabe in Deutschland und Großbritannien vor. Aufbauend auf Arbeiten der legal geographies lag der Fokus auf der Frage, wie sich sogenannte „legal pluralisms“ – also parallele und teils widersprüchliche gesetzliche Regelungen – auf das Engagement von Supermärkten, Freiwilligen und zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Lebensmittelspenden auswirken. Anhand von Interviewdaten zeigten die Referentinnen auf, dass zahlreiche Graubereiche und Haftungsrisiken bestehen, die die Umsetzung bestehender Nachhaltigkeitsziele erschweren.
In Session 6 analysierten Leonie Hesselmann und Javier Revilla Diez (Universität zu Köln) die Resilienz der Viehwertschöpfungskette in der Zambezi-Region Namibias im Kontext globaler Krisen. Aufbauend auf einem evolutionären Resilienzverständnis untersuchten sie anhand qualitativer Interviews und quantitativer Erhebungen, wie verschiedene Akteure – von Kleinbauern über Verbände bis hin zu politischen Entscheidungsträgern – von Krisen betroffen sind, welche Anpassungsstrategien sie wählen und welche Faktoren ihr Verhalten beeinflussen.
Danach gingen Jutta Kister (Universität Innsbruck) und Miriam Wenner (Universität Göttingen) der Frage nach, inwiefern Fairtrade-Zertifizierungen auf indischen Teeplantagen tatsächlich zu besseren Arbeitsbedingungen beitragen. Im Fokus stand das Konzept der existenzsichernden Löhne (living wages), das Fairtrade als Reaktion auf Kritik an der Konventionalisierung des fairen Handels eingeführt hat. Anhand eines moralgeographischen Ansatzes zeigte der Vortrag die begrenzte Reichweite des Instruments, insbesondere in Bezug auf die Mitbestimmung und Vertretung von Plantagenarbeiter*innen. Die Diskussion machte deutlich, dass der Begriff der Verantwortung in globalen Lieferketten häufig diffus bleibt.
Abschließend stellten Victoria Luxen und Peter Dannenberg (Universität zu Köln) eine Studie zur landwirtschaftlichen Intensivierung in Tansania vor. Auf der Basis von Paneldaten aus dem „Southern Agricultural Growth Corridor“ (SAGCOT) untersuchten sie, ob und wie sich kommerzielle Einbindung auf die Lebenszufriedenheit von Kleinbauern auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz wachsender Marktintegration viele strukturelle Hürden weiterbestehen – etwa geringe Verhandlungsmacht und hohe Preissensibilität–, die die Zufriedenheit nicht direkt steigern. Hingegen führten Verbesserungen in der Infrastruktur (z. B. Strom, Straßen, Bildung) zu einem gefühlten Anstieg der Lebensqualität.
In der Mitgliederversammlung des AKs wurden kurz wichtige organisatorische Punkte angesprochen (insbesondere Stand der gegenwärtigen Veröffentlichungen, Ausblick). Besonders gedankt wurde Franziska Czernik (Universität Vechta), die bisher die Webseite des Arbeitskreises betreut hat. Diese Aufgabe wird ab Mitte August von Mirka Erler (ebenfalls Universität Vechta) übernommen.
Der Arbeitskreis bedankt sich ausdrücklich beim Organisationsteam am Standort Osnabrück – insbesondere Martin Franz, Jana Rülke und Dana Schroeder – für die hervorragende Ausrichtung der 2025-er Tagung. Die Jahrestagung wird 2026 voraussichtlich in Berlin stattfinden; 2027 in Köln. Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Wer noch nicht auf dem Mailverteiler des AKs ist und aufgenommen werden möchte, sendet bitte eine kurze Mail an: amelie.bernzen@uni-vechta.de
Für das Sprecherinnenteam des AKs
Anika Trebbin, Doris Schmied, Amelie Bernzen